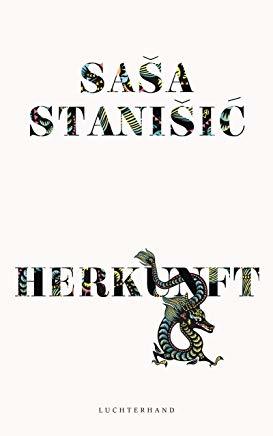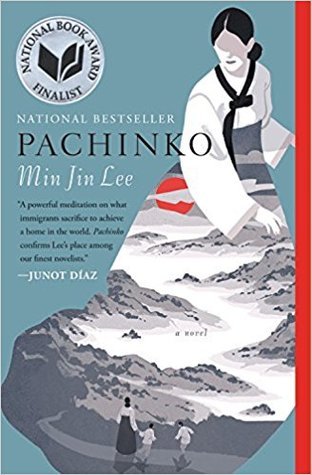Von Verena Kauzleben
Es ist ein schöner spätsommerlicher Sonntagnachmittag. Acht Menschen kommen im Kölner Parkcafé am Rhein zusammen, um über das Ende der Ehe zu diskutieren. Inspiriert von Emilia Roigs Buch „Das Ende der Ehe“. Aber Moment, das Ende der Ehe? Nein, darum geht es eigentlich gar nicht speziell in ihrem Buch, sondern vielmehr um eine Kritik an heterosexuellen Beziehungen allgemein. Ein paar allgemein feministische Ansichten gibt es gratis on top – die haben zwar nichts mit Beziehungen speziell zu tun. Aber macht nichts, fügen sie sich doch gut ein. So ist Vieles bei Roig allgemein und verallgemeinert statt speziell – wie der Titel uns suggeriert hatte.
So beginnt unser Treffen damit, darüber nachzudenken, inwiefern reißerische Titel das Bestseller Potential eines Buches erhöhen und ob sich das lohnt. Denn wer würde sich schon für „Allgemein feministische Ansichten zu verallgemeinerten heterosexuellen Beziehungen“ erwärmen oder gar erhitzen? „Das Ende der Ehe“ emotionalisiert schon deutlich mehr. Und klar Emotionen braucht es, um den Geldbeutel zu öffnen und Talkshow-Einladungen zu generieren. Und bei uns hat es ja schließlich auch funktioniert.
Also lassen wir uns bei Cappuccino und Sonnenschein auf die Gedanken Roigs hinter dem Titel ein.
Roigs Hauptargumentationslinie lautet: Wegen des Ehegattensplittings rutsche die Frau in die Teilzeitfalle und übernehme einen größeren Anteil der Care-Arbeit in einer Beziehung oder Familie. Das führe zur systemischen Benachteiligung der Frau und mache sie auf Dauer abhängig von ihrem männlichen Partner. Trotzdem sei aber die Ehe oder eine heterosexuelle Beziehung ein gesellschaftlich anerkannter Status und wir würden von Kindesbeinen an kulturell geprimt, dies anstreben zu wollen. Laut Roig gehe es bei dem Eingehen einer heterosexuellen Beziehung oder Ehe insbesondere darum, ein früh erlerntes inneres Skript umzusetzen, gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden und diesen höheren Status zu erlangen. So diene heute die Ehe vielen der Identitätsausbildung.
In unserer sommerlichen Parkrunde führen uns diese Gedanken dazu, zu erforschen, warum Menschen heute überhaupt heiraten. Dabei zeigt sich, in manchen Freundeskreisen unserer heterogenen Gruppe ist die Ehe die Norm, in anderen spielt sie keine Rolle. Der eine ist selbst gerade zwei Wochen verheiratet, die andere geschieden, der nächste verwitwet und die letzte Großstadtsingle. Wir fragen uns, ob viele (junge) Menschen heiraten, um eine Sehnsucht nach Sicherheit mit der Ehe zu stillen. In einer Zeit, in der andere sicherheitsspendende Leitplanken wie Traditionen, Großfamilie oder Religion, lineare Arbeitsbiografien verblassen. Und eigentlich sowieso und überhaupt unsere Zukunft mit Kriegen und Klimakrise und der Zunahme von Autokratien in der Welt unsicherer erscheint. Auch Roig führt hier einen Gedanken zu an: Ein Grund für die Ehe sei die Idee und der Wunsch, dass alles so bleibe wie es ist (S.60). Verführerisch.
Neben der vermeintlichen Sicherheit einer Ehe, betrachten wir – wie Roig – die rechtliche Absicherung und ggf. steuerliche Vorteile als Gründe, um eine Ehe einzugehen. Und unsere Gruppe würde sich unisono wünschen, dass diese veraltet scheinenden Regelungen abgeschafft würden, da sie tatsächlich Frauen langfristig benachteiligen.
Apropos veraltet, manche von Roigs Argumenten scheinen uns doch sehr in die Jahre gekommen zu sein: die Hauptfunktion der Ehe sei, den Körper der Frau zu kontrollieren (S. 32 f.), die Ehe basiere auf der Heterosexualität (S.207) und solle in der Vorlage Männer lieben Frauen und umgekehrt stattfinden (S.39) usw.
Beeinflusst vom guten Wetter und der netten Runde wollen wir nicht in Kritik verharren und sehnen uns nach Perspektiven. Denn wer ein Ende fordert, sollte doch einen Anfang vorschlagen – oder?
Hier bietet Roig ihre persönliche Erfahrung einer homosexuellen Beziehung an, in der viele der patriarchal bedingten Probleme einer heterosexuellen Beziehung nicht auftauchten. Unserer Parkrunde ist dies als allgemeiner Lösungsvorschlag nicht genug. So klammern wir uns noch eine Zeitlang an eine andere, dürftiger ausgeführte Idee der Autorin: das Leben in Communitys statt in isolierten Paarbeziehungen. Die Idee scheint uns reizvoll. Die Amatonormativität, also das stetige Priorisieren einer Liebesbeziehung über andere soziale Beziehungen, aufzulösen. Warum lautet der Normalzustand, mit dem/der LiebespartnerIn die Wohnung zu teilen und der Urlaub oder das Familienfest primär mit dem Partner, statt mit guten Freunden verbracht wird? Wir testen die Idee in einem Gedankenexperiment: Wie wäre es, mit unseren Freunden so eng zusammen zu leben oder zu verreisen wie mit Partnern? Schnell zeigt sich: Es tauchen ähnliche Konflikte am Horizont auf. Die Erfahrungen haben viele von uns gemacht. Die eine putzt mehr in der WG, geht häufiger einkaufen, nimmt mehr Rücksicht. Und im Urlaub ist der andere schon an Tag zwei genervt ob so viel Nähe mit den Freunden, die dann doch auch sehr anders ticken. Gleichzeitig aber der amoröse und körperliche Kitt fehlt.
Wir halten also eine grundsätzliche Sympathie für das Aufwerten von anderen sozialen Beziehungen fest, wünschen uns ein Ende des Ehegattensplittings und allgemein bitte eine bessere Kinderbetreuung, weil DAS auf einen Schlag und weitreichend Benachteiligungen von Frauen in unserer Gesellschaft auflösen würde. So gehen wir auseinander, voller Gedanken und dankbar für den gleichzeitig wertfreien und wertvollen Austausch und diesen spätsommerlichen Nachmittag im Park.